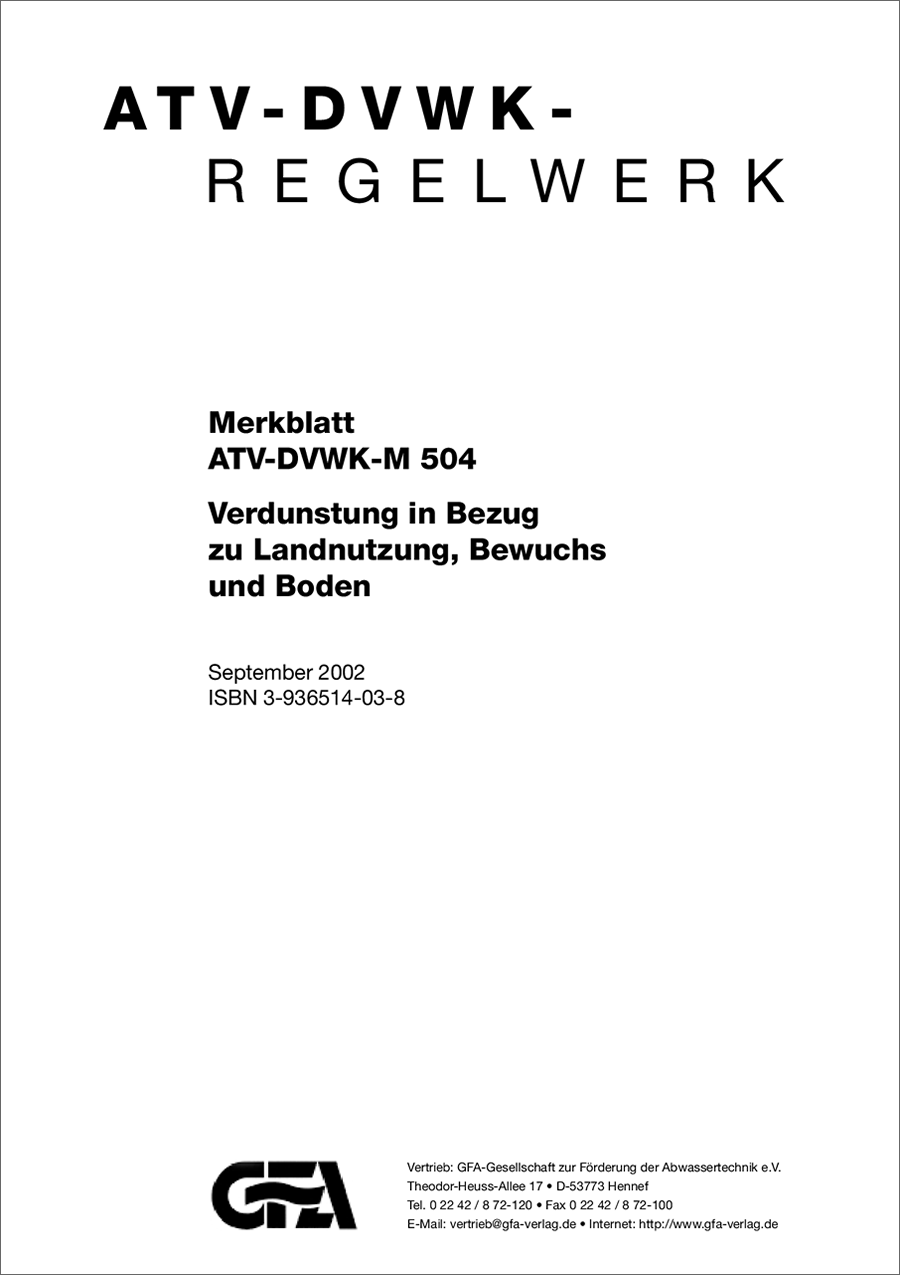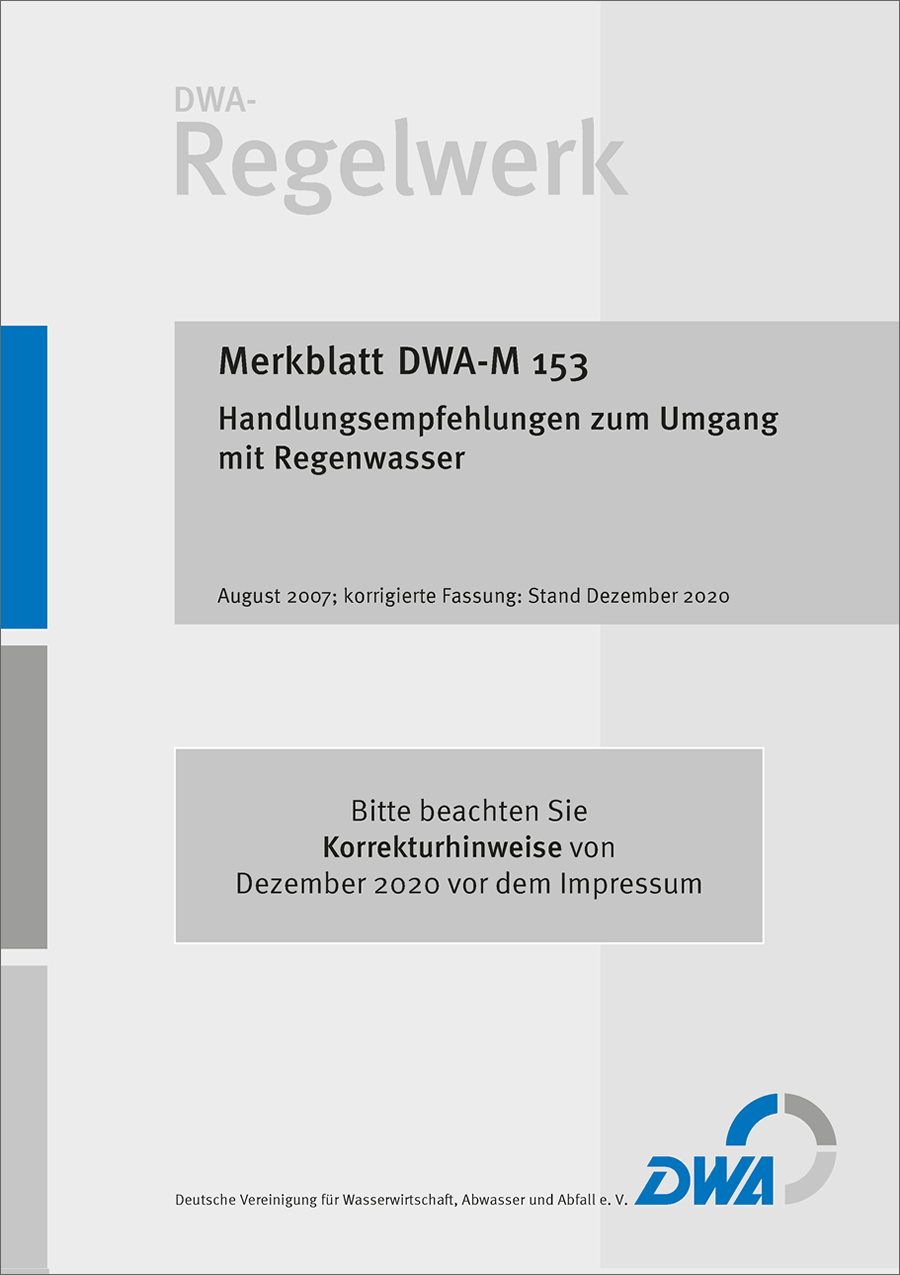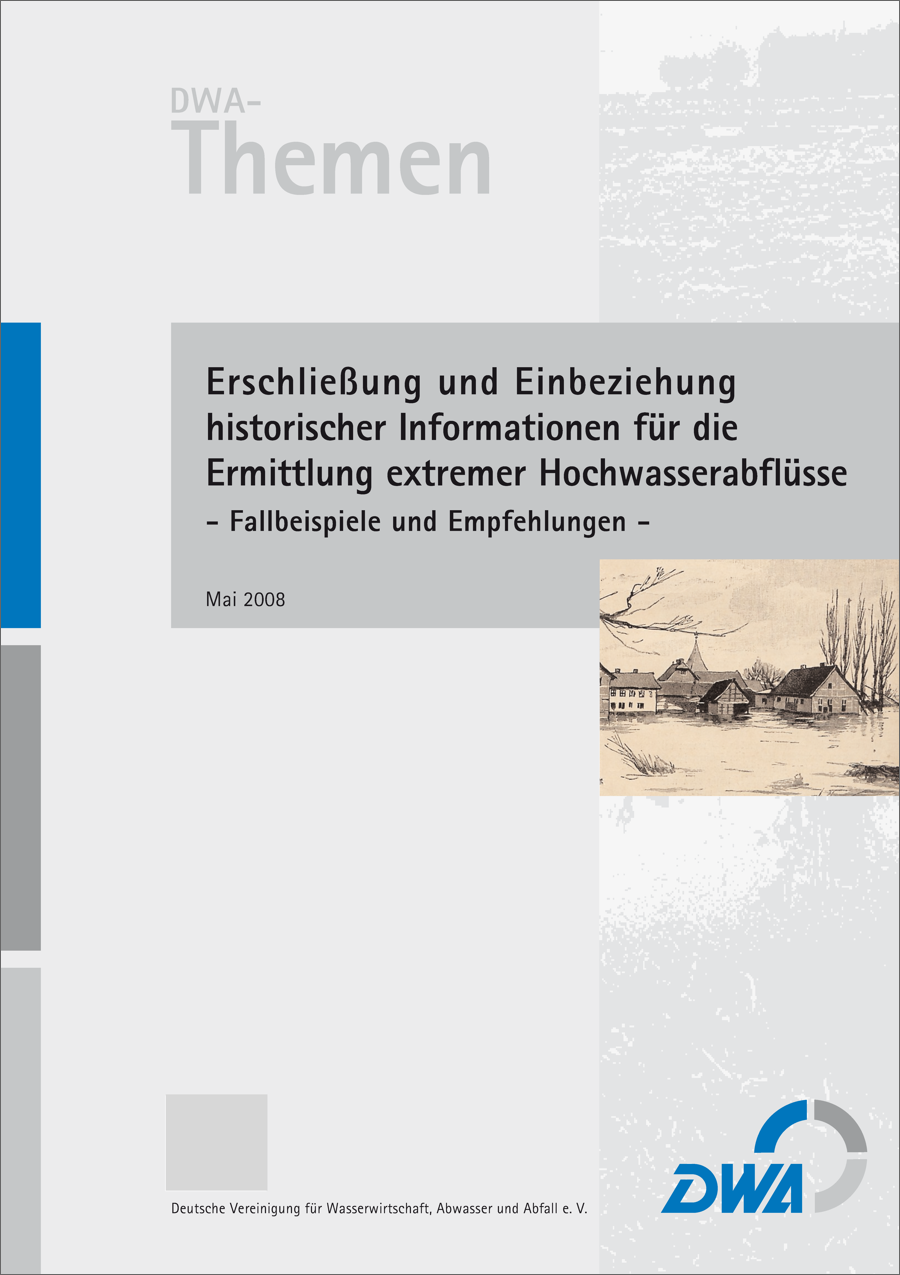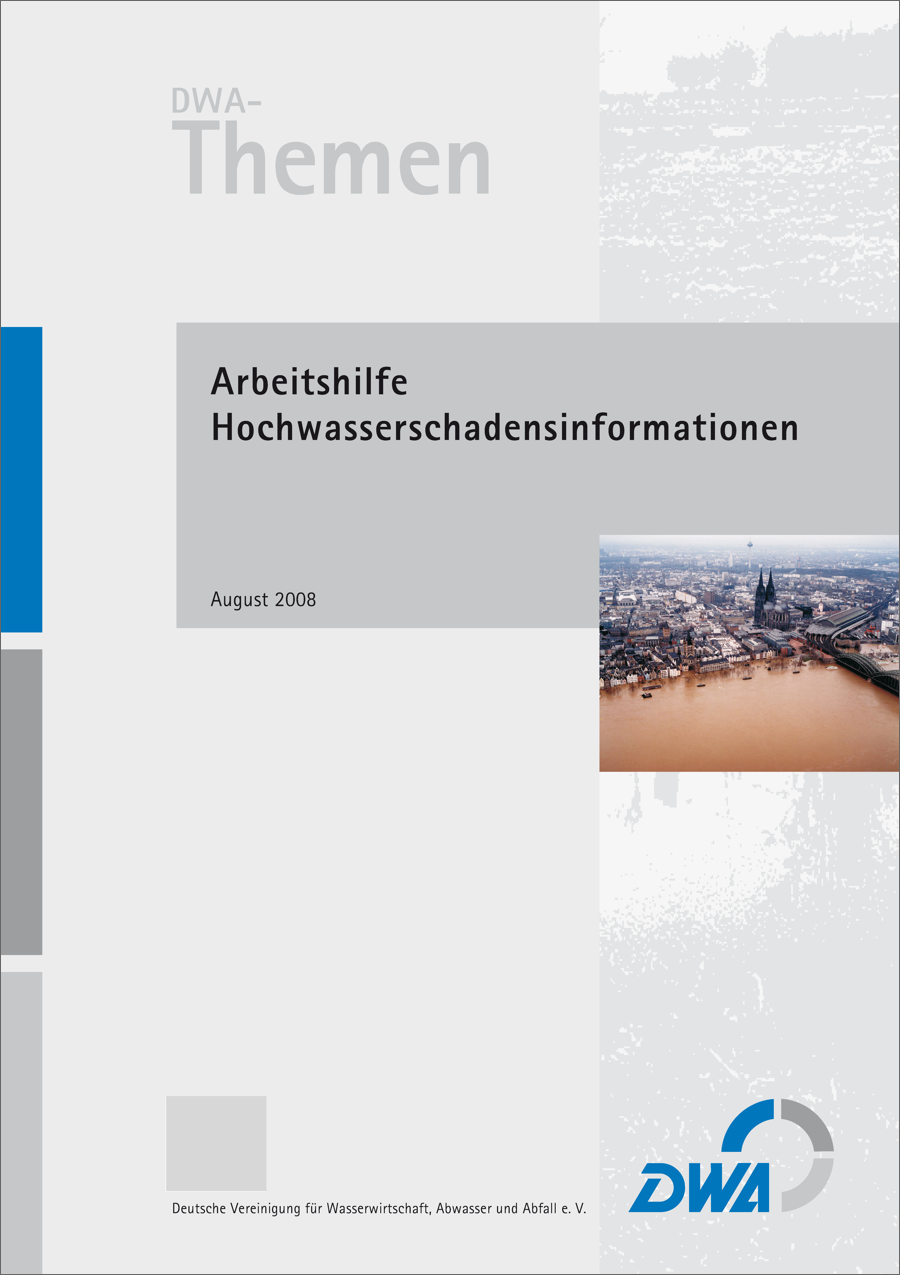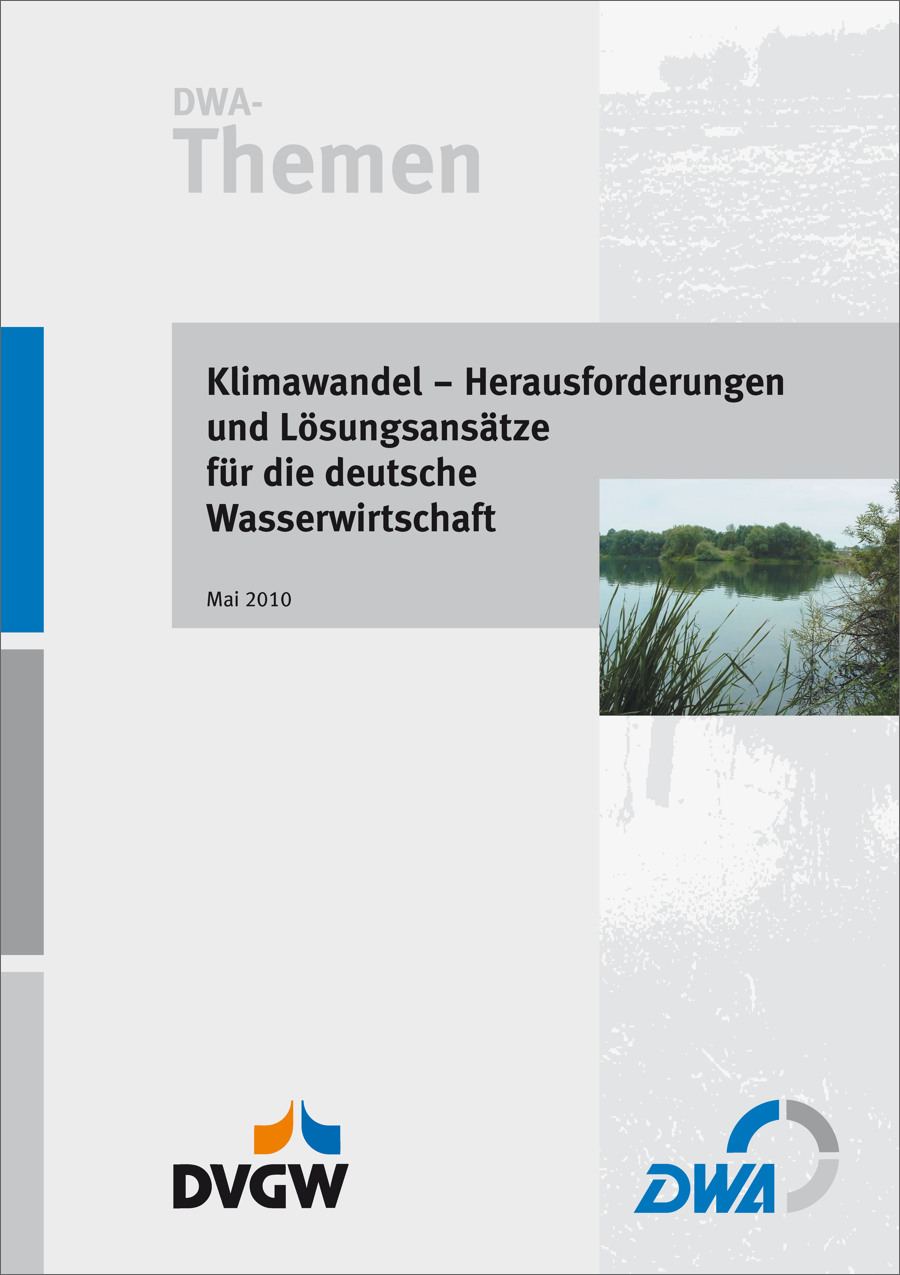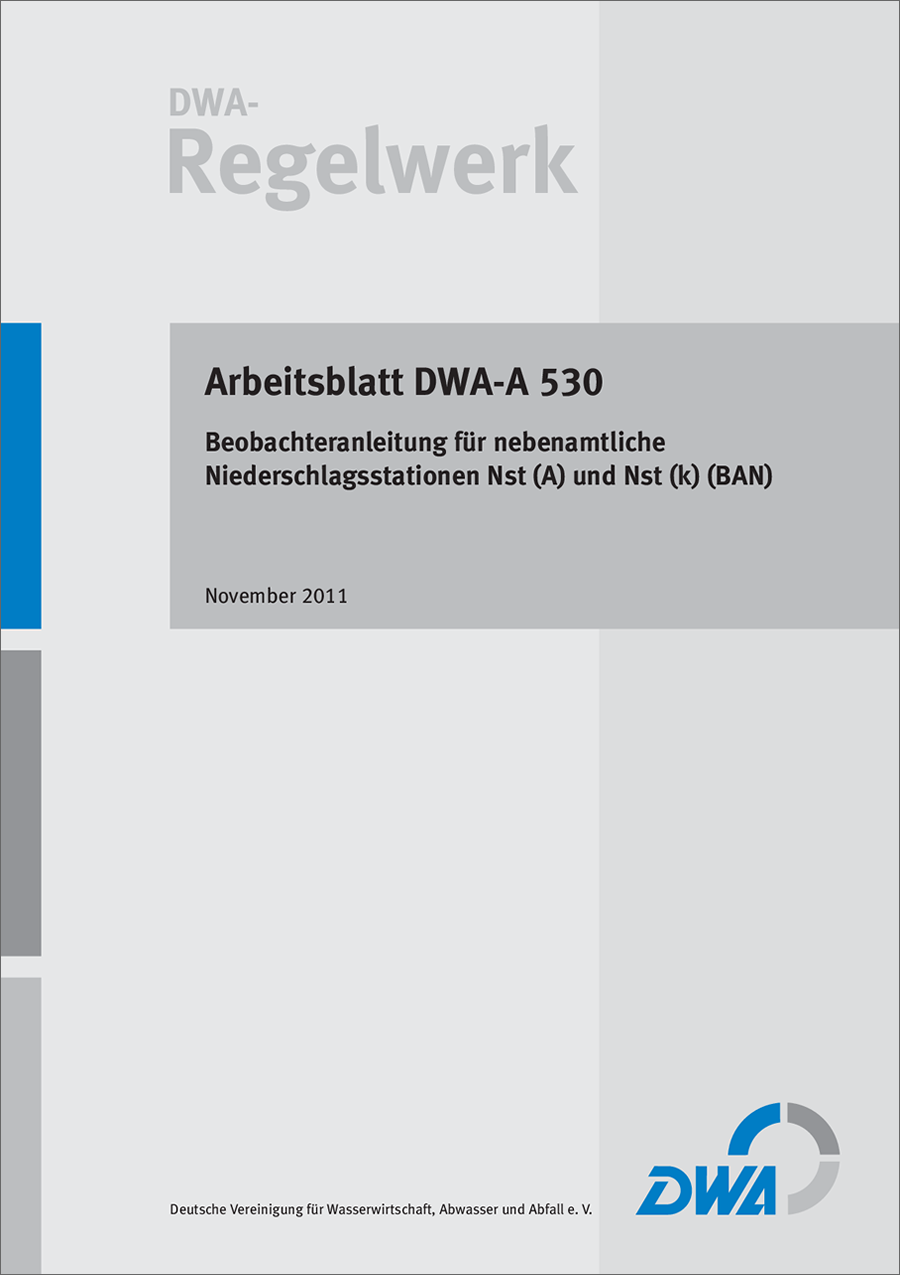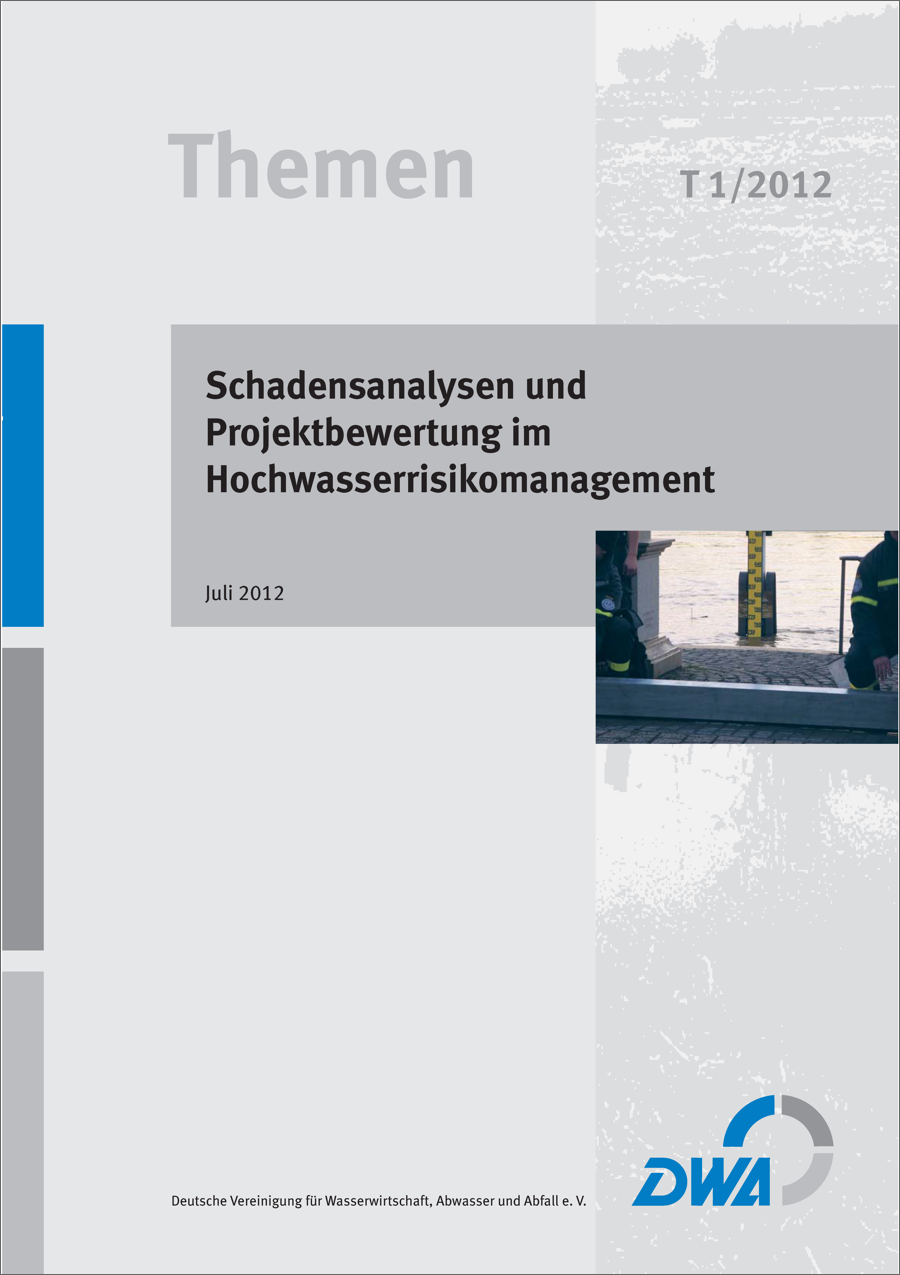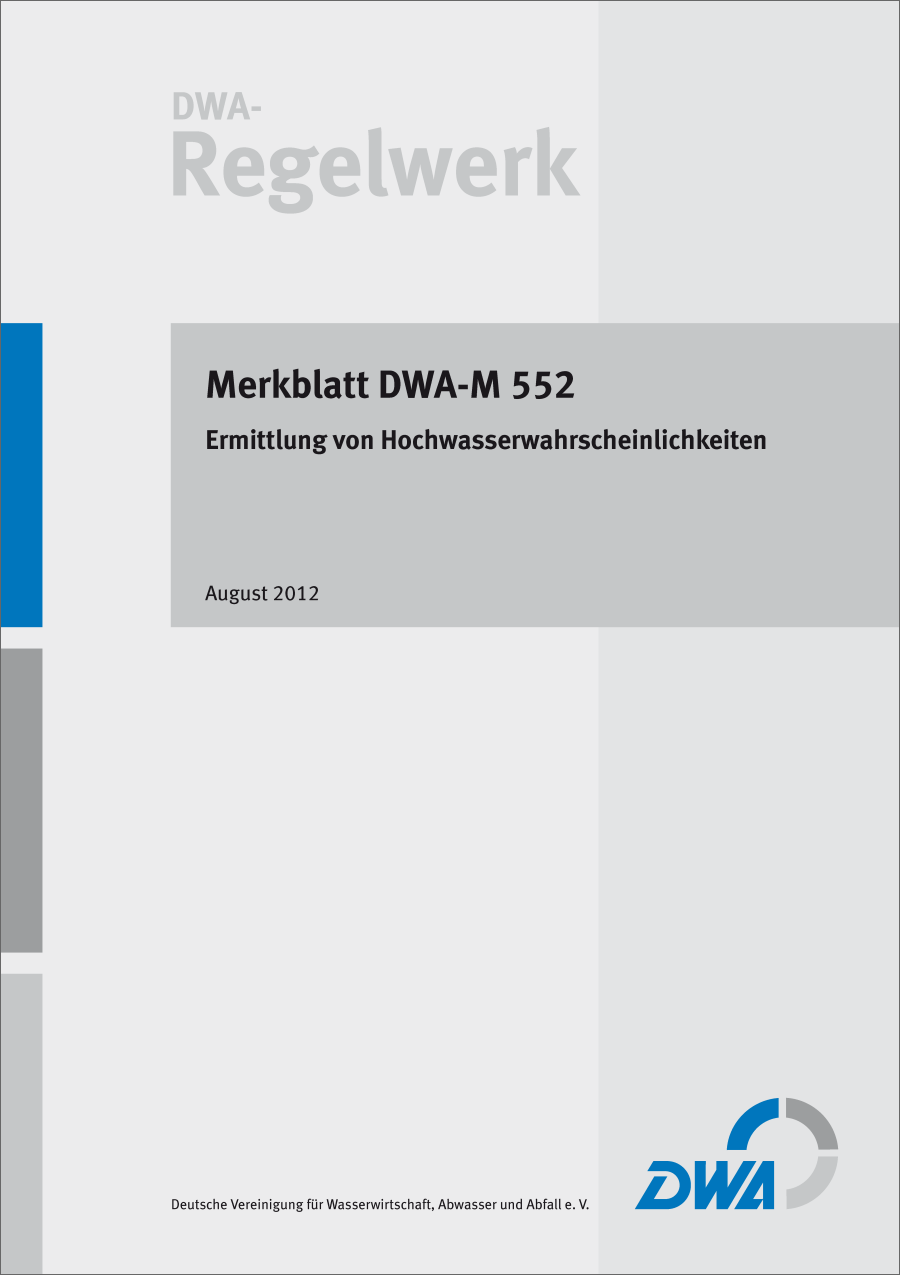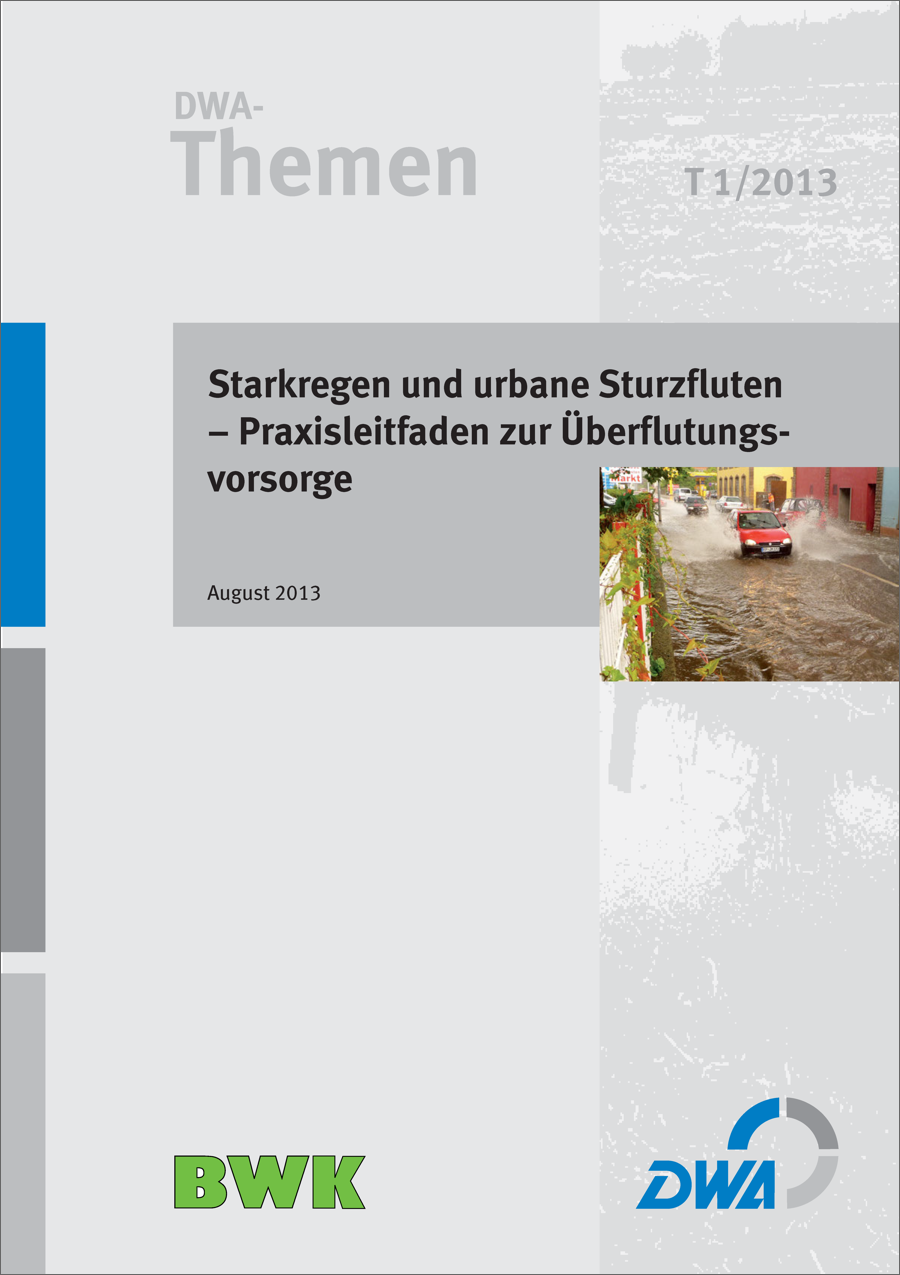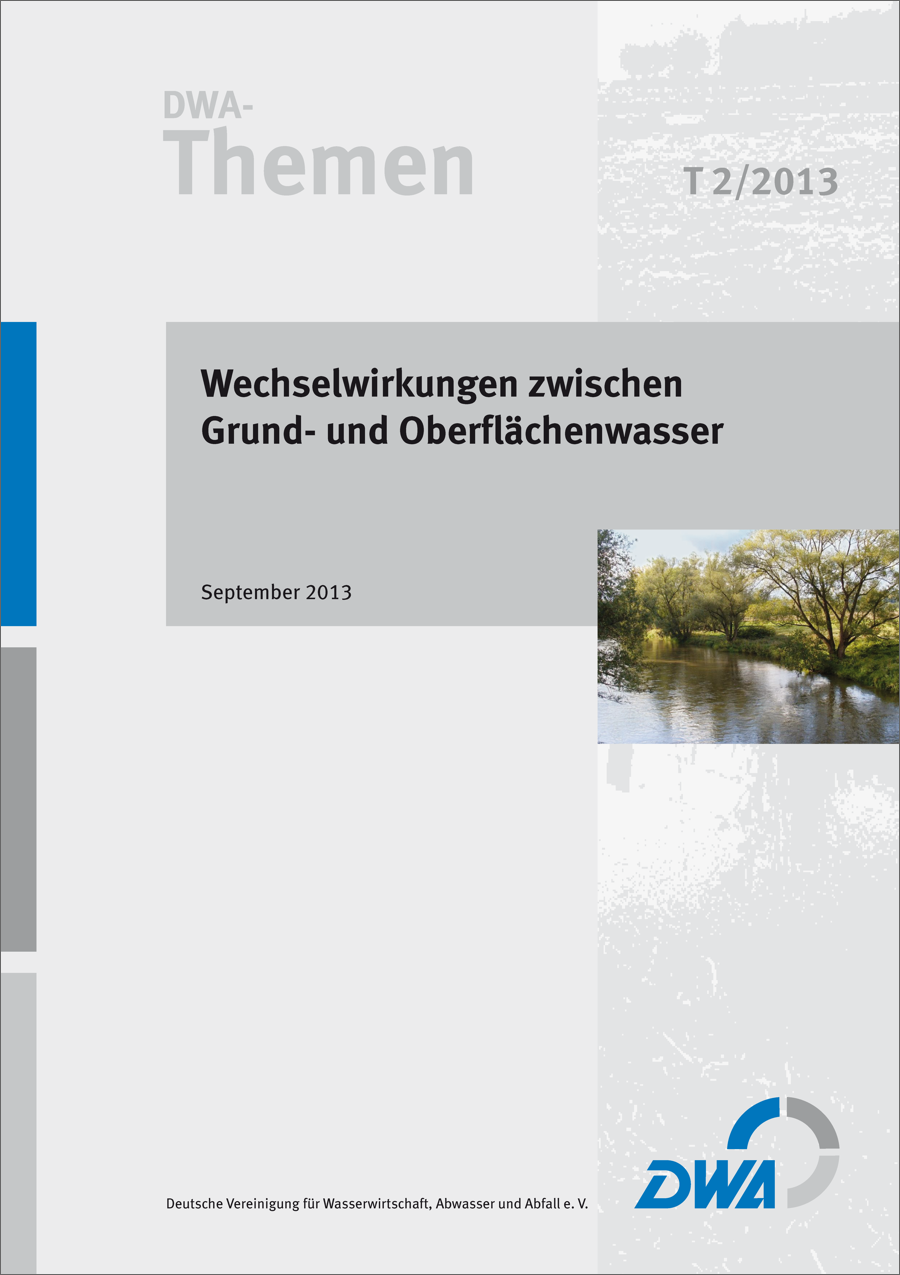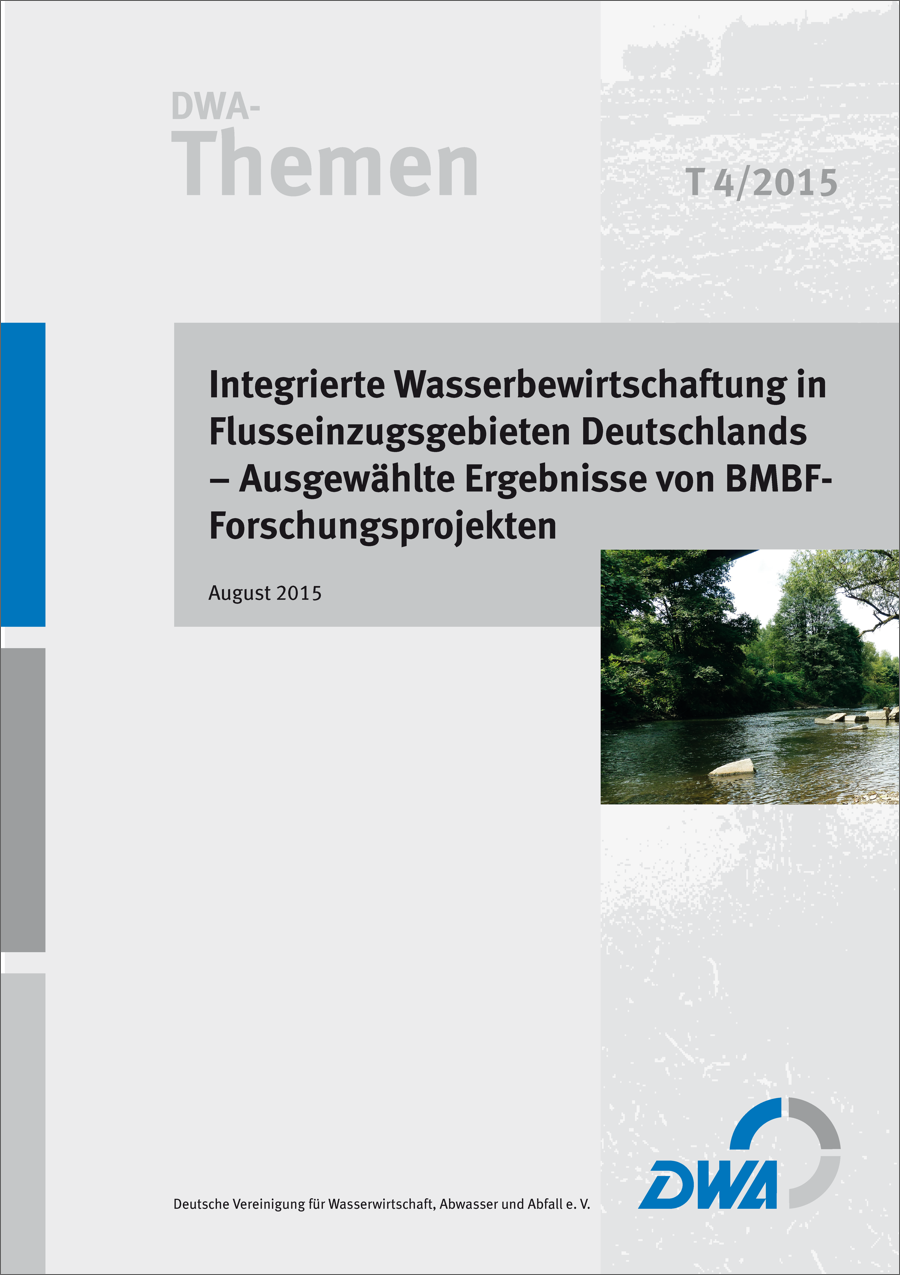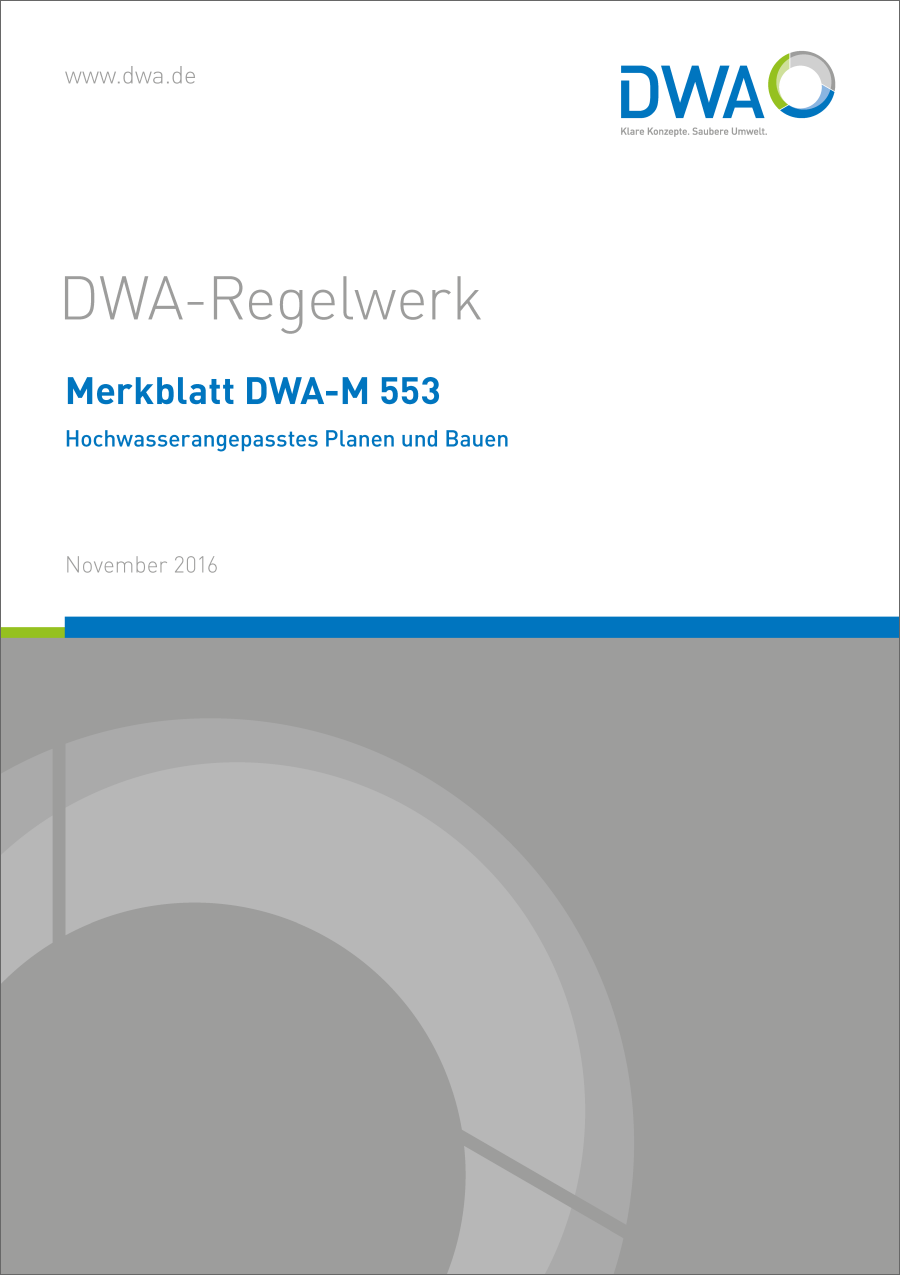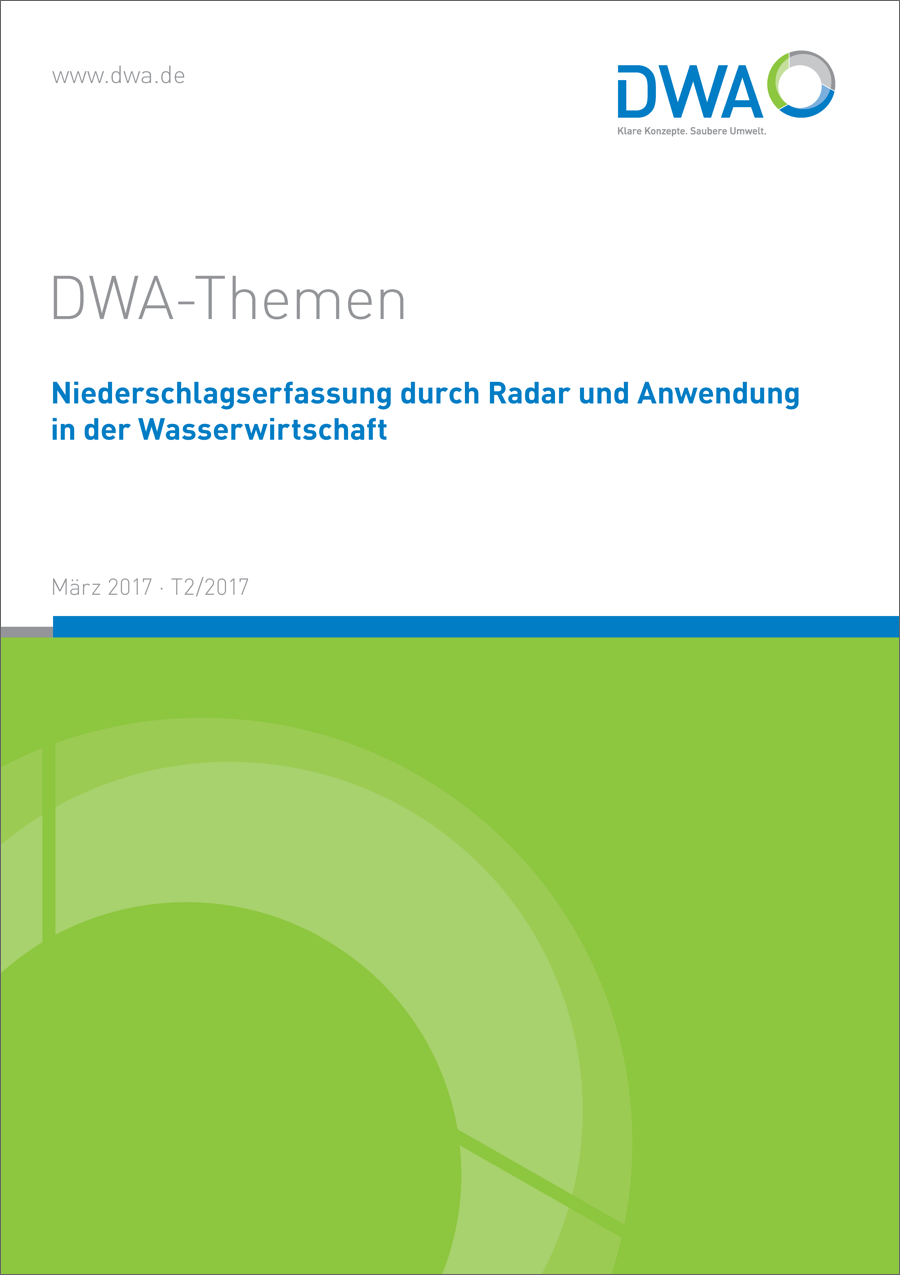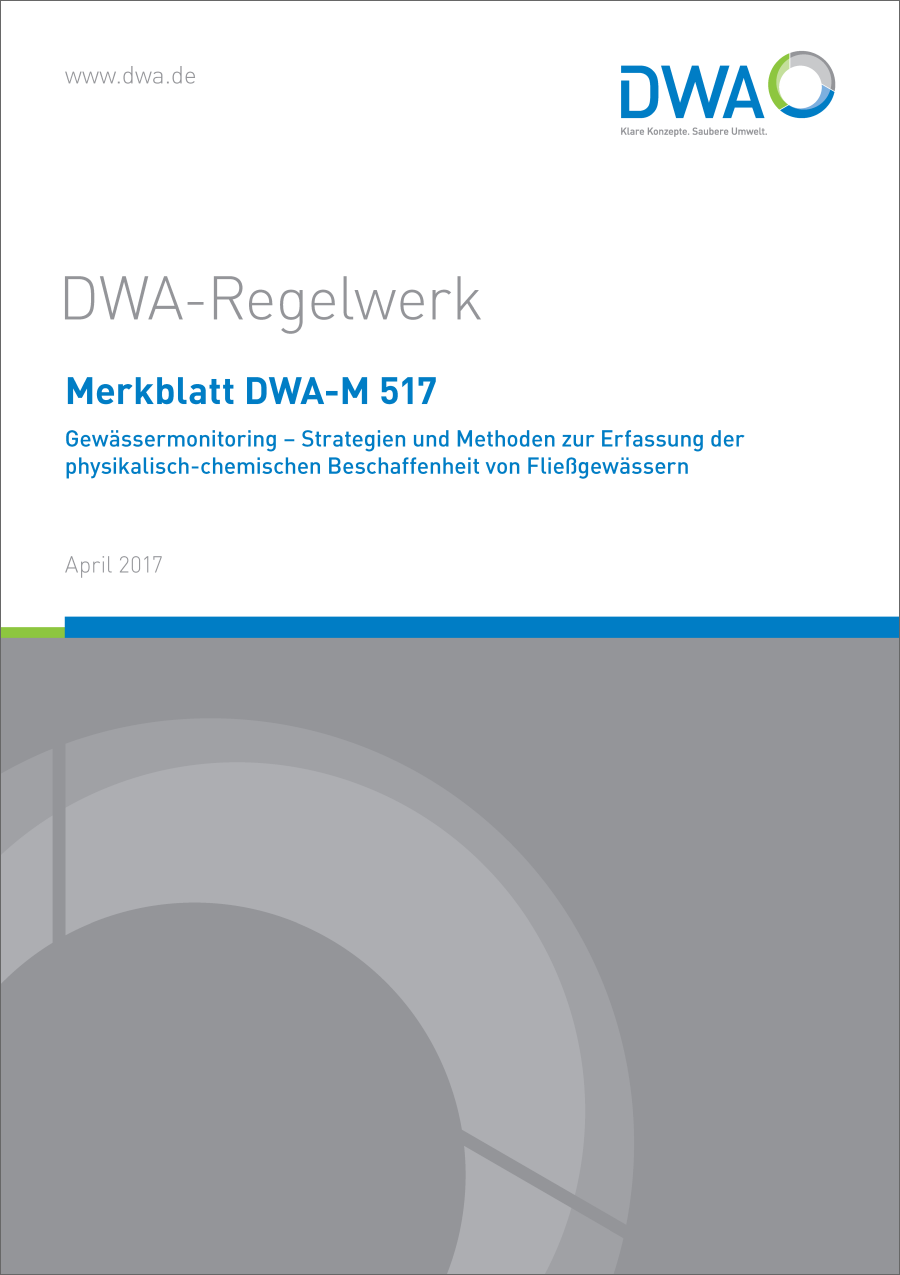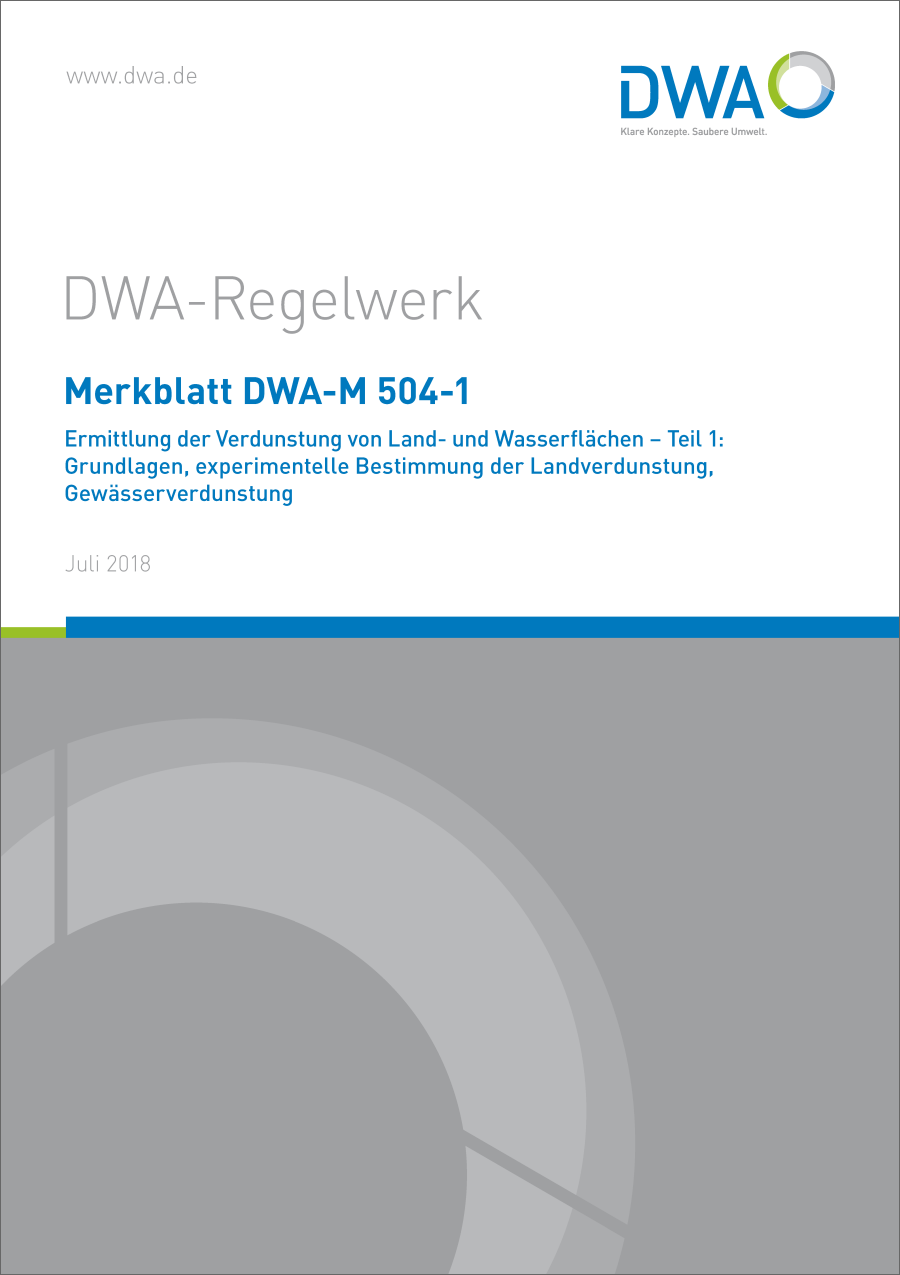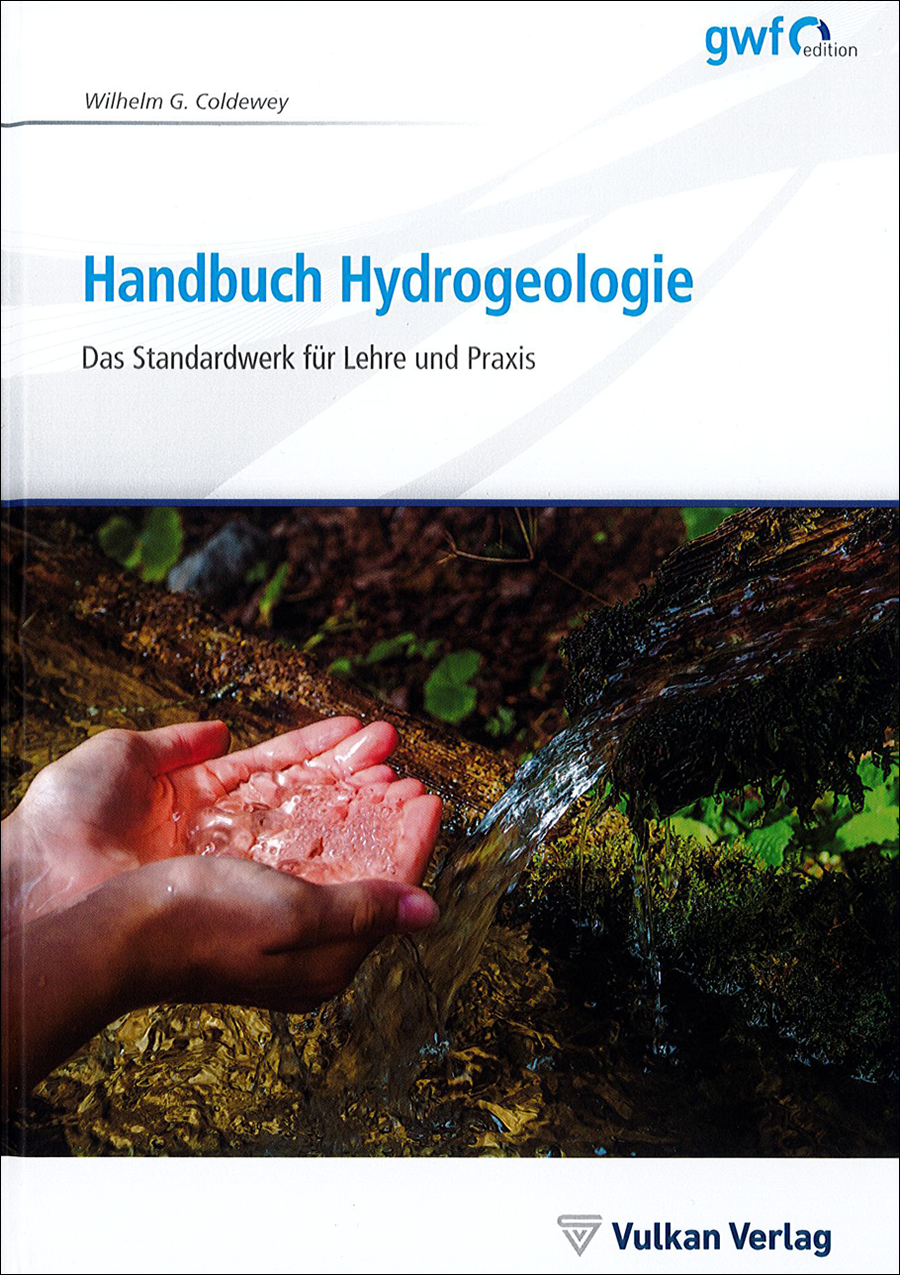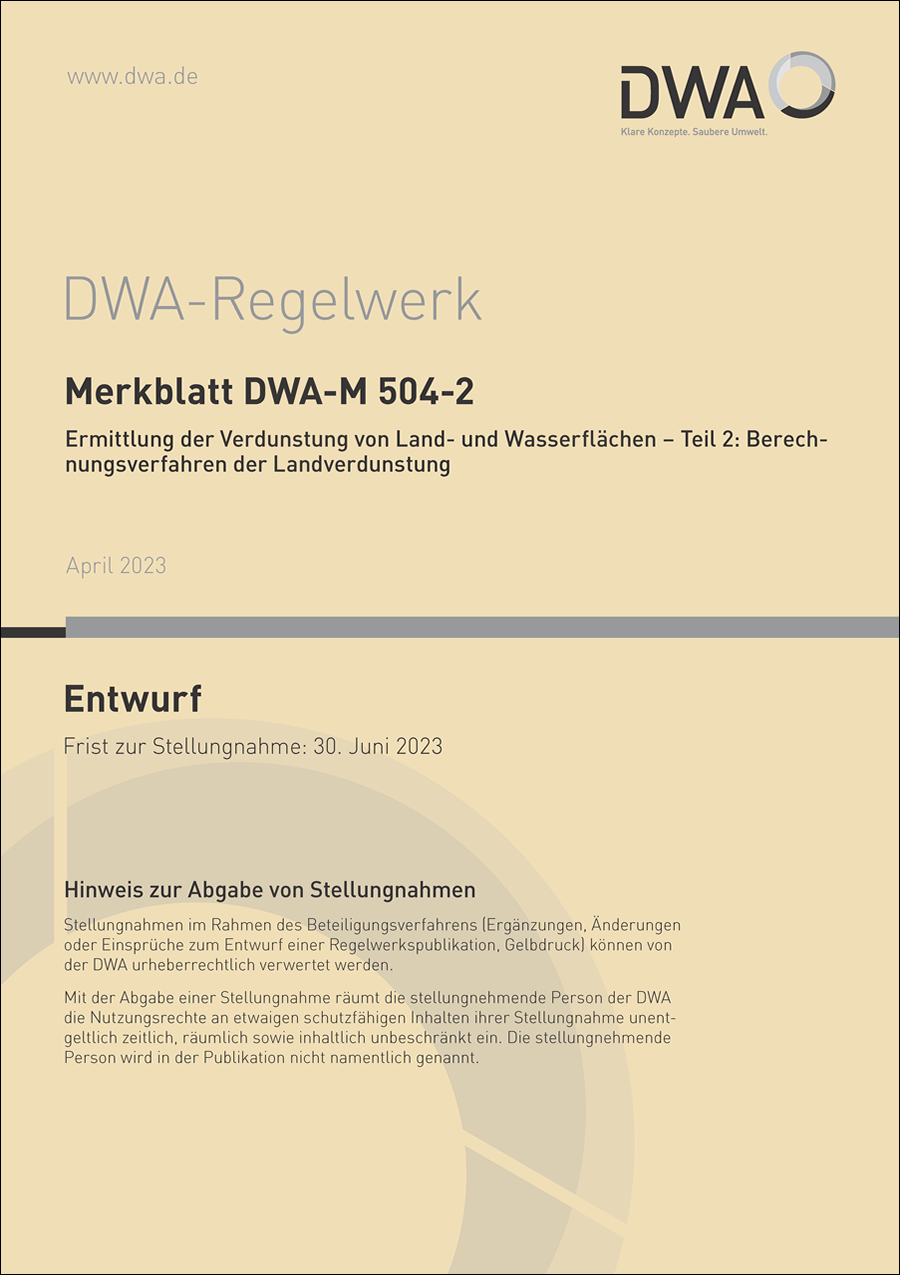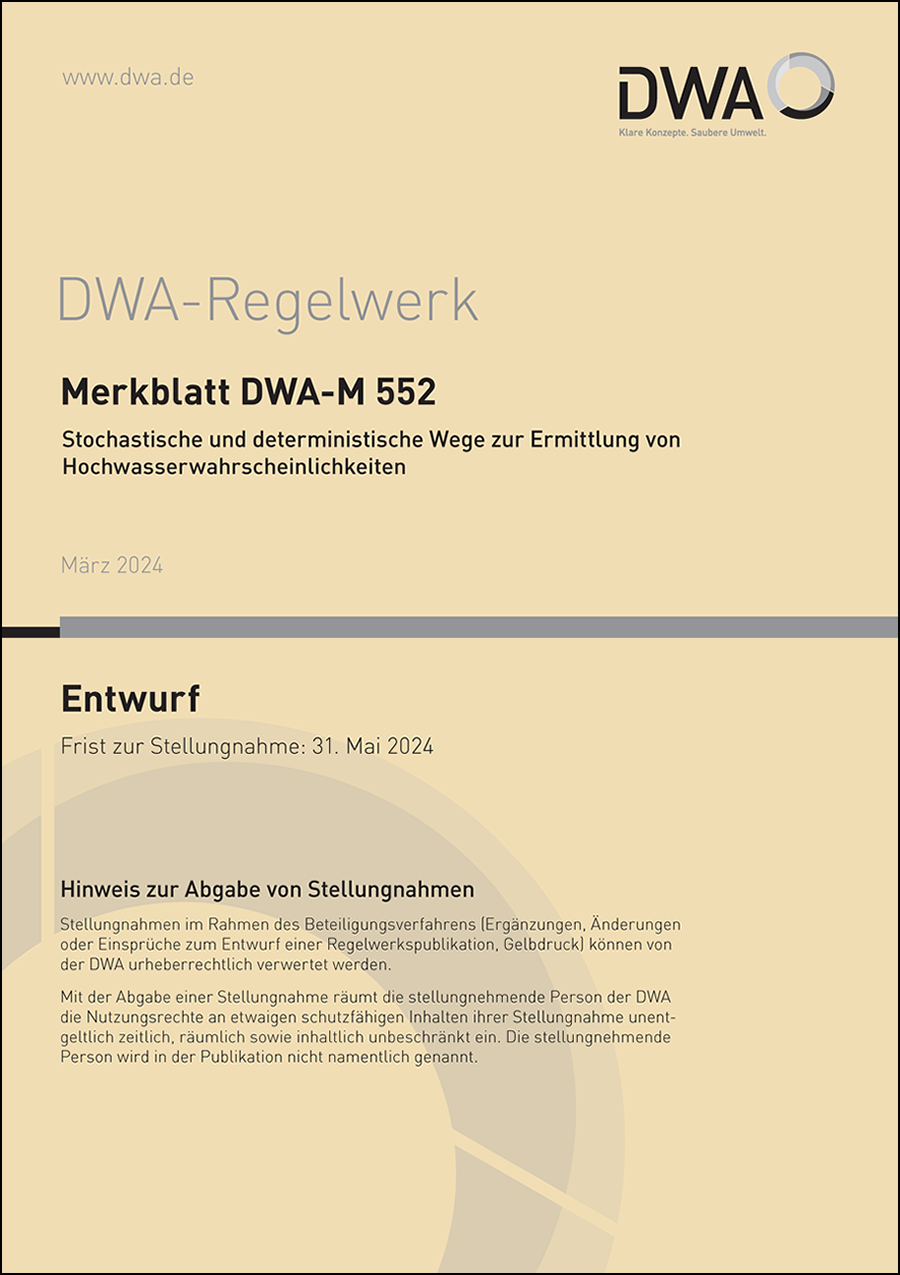ATV-DVWK-M 504 - Verdunstung in Bezug zu Landnutzung, Bewuchs und Boden - September 2002
Die im Merkblatt vorgestellten Methodiken sollen grundlegende Fragen der Verdunstungsermittlung klären, die im Zusammenhang mit Landnutzungsänderungen zu berücksichtigen sind. Empfohlen wird ein mathematisches Modell zur Auswertung von Lysimeterdaten in Hinsicht auf Gebietsverdunstung unter unterschiedlichen Boden-, Bewuchs- und Landnutzungssystemen.
49,50 €*
DWA-M 153 - Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser - August 2007; Stand: korrigierte Fassung Dezember 2020
Das Merkblatt enthält Empfehlungen zur mengen- und gütemäßigen Behandlung von Regenwasser in modifizierten Entwässerungssystemen oder in Trennsystemen. Es analysiert und strukturiert die komplexen Zusammenhänge zwischen Verschmutzung und Menge des Regenwassers je nach Nutzung und Belag der Herkunftsfläche, dem Schutzbedürfnis des Grundwassers, dem Schutzbedürfnis der oberirdischen Gewässer und daraus abgeleitet die gegebenenfalls erforderliche Regenwasserbehandlung vor einer Versickerung oder vor einer Einleitung in oberirdische Gewässer.
46,00 €*
DWA-Themen - Erschließung und Einbeziehung historischer Informationen für die Ermittlung extremer Hochwasserabflüsse - Fallbeispiele und Empfehlungen - Mai 2008
Der Themenband vereinigt ausgewählte Forschungsergebnisse zum Risikomanagement extremer Hochwasserereignisse. In der vom BMBF initiierten Förderaktivität konnten neben herausragenden Hochwassern der letzten Jahrzehnte auch sehr seltene Abflussereignisse vor 1900 untersucht werden
38,50 €*
DWA-Themen - Arbeitshilfe Hochwasserschadensinformationen - August 2008
Was beim Beschaffen, Auswerten und Wiederverwenden von Hochwasserschadensdaten und daraus abgeleiteten Schadensinformationen alles zu bedenken ist und was zu unternehmen ist, um wirklich gute Planungen entwickeln zu können, wird in diesem Themenband behandelt.
38,50 €*
DWA-Themen - Klimawandel - Herausforderungen und Lösungsansätze für die deutsche Wasserwirtschaft - Mai 2010
Der Themenband benennt die zu erwartenden Änderungen in den Bereichen Hydrologie, Wasserbau, Wasserversorgung, Siedlungsentwässerung, Gewässerökologie, Wirtschaft sowie Kommunikation und Kooperation.
35,00 €*
DWA-A 530 - Beobachteranleitung für nebenamtliche Niederschlagsstationen Nst (A) und Nst (K) (BAN) - November 2011
Das Arbeitsblatt spezifiziert die Vorgaben, die für die Umsetzung der hohen Anforderungen bei der Beobachtung an nebenamtlichen Stationen zu berücksichtigen sind. Der Fokus liegt dabei auf der Niederschlagsbeobachtung. Die Regelungen dieser Beobachteranleitung dienen einem Standard für die sachlich homogene Datenerfassung an Wetterstationen.
39,00 €*
DWA-Themen T1/2012 - Schadensanalysen und Projektbewertung im Hochwasserrisikomanagement - Juli 2012
Ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Umsetzung von Hochwasservorsorgemaßnahmen ist die Projektbewertung und ihre Einordnung im Rahmen von Hochwassermanagementplänen. Mit diesem Band wird das Gesamtthema um den aktuellen Stand der Technik ergänzt und erweitert. Mit praktischen Beispielen werden Anregungen zur Erarbeitung individueller Lösungen für jede Fragestellung im Rahmen der Projektbewertung vorgestellt.
92,50 €*
DWA-M 552 - Ermittlung von Hochwasserwahrscheinlichkeiten - August 2012
Das Merkblatt gibt Empfehlungen und Informationen für die Ermittlung von Hochwasserwahrscheinlichkeiten in Fortschreibung und Ergänzung hierzu gebräuchlicher statistischer Verfahren und Methoden durch verschiedene Ansätze zur zeitlichen, kausalen und räumlichen Informationserweiterung. Damit sollen die Anwendungen verschiedener methodischer Ansätze und die Kombination der Ergebnisse, im Sinne einer Plausibilisierung der ermittelten Hochwasserwahrscheinlichkeiten, gefördert werden.
88,50 €*
DWA-Themen T1/2013- Starkregen und urbane Sturzfluten - Praxisleitfaden zur Überflutungsvorsorge - August 2013
Der Überflutungsvorsorge muss innerhalb der Kommunen eine erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wie entsprechende Betrachtungen und geeignete Planungsansätze aussehen können, zeigt der neue Themenband auf, um eine Hilfestellung für den Einstieg in eine wirkungsvolle Vorsorgeplanung zu bieten.
60,50 €*
DWA-Themen T2/2013 - Wechselwirkungen zwischen Grund- und Oberflächenwasser - September 2013
In den letzten Jahren wurden zahlreiche Verfahren und Modelle für die Beschreibung und Quantifizierung der hydrologischen, hydraulischen, geochemischen und biologischen Prozesse zwischen Grund- und Oberflächenwasser entwickelt und angewandt. Dieser Themenband zeigt den Stand auf diesem Gebiet.
103,50 €*
DWA-Themen T4/2015 - Integrierte Wasserbewirtschaftung in Flusseinzugsgebieten Deutschlands - ausgewählte Ergebnisse von BMBF-Forschungsprojekten inkl. CD-ROM - August 2015
Spätestens seit Einführung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in die nationale Gesetzgebung folgen heute die Fachplanungen diesen theoretischen Grundgedanken in der praktischen Umsetzung. Viele Ansätze wurden neu entwickelt und in Forschungsprogrammen erprobt und umgesetzt. In dem vorliegenden Themenband werden Beispielhaft Umsetzungen eines Integrierten Wasserressourcen-Managements vorgestellt und erörtert.
78,50 €*
DWA-M 553 - Hochwasserangepasstes Planen und Bauen - November 2016
Das Merkblatt bietet eine fundierte und strukturierte Darstellung der Europäischen Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie für die Praxis, auf deren Grundlage fachgerechte Planungen und bauliche Umsetzungen im gesamten Themenspektrum des hochwasserangepassten Planens und Bauens getroffen werden können. Es beschreibt die wichtigsten Strategien zur Risikominderung und ihre grundsätzlichen Handlungsoptionen: Ausweichen, Widerstehen, Anpassen.
104,00 €*
DWA-Themen T2/2017 - Niederschlagserfassung durch Radar und Anwendung in der Wasserwirtschaft - März 2017
Im Themenband wird der aktuelle Stand der Radarprodukte des DWD für die Niederschlagserfassung umfassend vorgestellt.
109,50 €*
DWA-M 517 - Gewässermonitoring - Strategien und Methoden zur Erfassung der physikalisch-chemischen Beschaffenheit von Fließgewässern - April 2017
Das Merkblatt gibt einen Überblick über die Methoden zur Erfassung der physikalischen und chemischen Wasserbeschaffenheit der oberirdischen Fließgewässer und ist somit für die Anwendung bei Monitoringsystemen im Zuge der Flussgebietsbewirtschaftung bzw. bei der Umsetzung der EG-WRRL geeignet.
99,00 €*
DWA-M 504-1 - Ermittlung der Verdunstung von Land- und Wasserflächen - Teil 1: Grundlagen, experimentelle Bestimmung der Landverdunstung, Gewässerverdunstung - Juli 2018
Der Teil 1 des Merkblatts DWA-M 504 beschreibt die Grundlagen, die experimentelle Bestimmung der Landverdunstung und die Gewässerverdunstung.
127,00 €*
Handbuch Hydrogeologie - 1. Auflage 2022
Dieses Standardwerk bietet das umfangreiche Wissen sowie die notwendigen Werkzeuge und Methoden zur Erkundung und Überwachung des Grundwassers.
149,00 €*
Merkblatt DWA-M 504-2 - Ermittlung der Verdunstung von Land- und Wasserflächen - Teil 2: Berechnungsverfahren der Landverdunstung - Entwurf April 2023
Das DWA-M 504 stellt einen weiten Bereich an Methoden bzw. Landnutzungs- und Vegetationseinflüssen in Mitteleuropa vor. Der Teil 2 widmet sich den Berechnungsverfahren, der Bereitstellung von Parametern und Eingangsgrößen sowie dem Einfluss von Klimaänderungen.
148,00 €*
DWA-M 552 - Stochastische und deterministische Wege zur Ermittlung von Hochwasserwahrscheinlichkeiten - Entwurf März 2024
Auf Basis der Erfahrungen aus den letzten Extremhochwassern werden mit der daraus resultierenden neuen Datenbasis neue hydrologische Erkenntnisse in dem Merkblatt dargestellt
98,00 €*